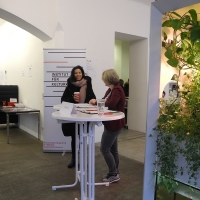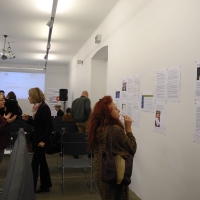Volle Führungskraft voraus! – Das Kulturmanagement Forum 2019
Ein beitrag von Ulli Koch
Kulturbetriebe sind Unternehmungen, die in die Zukunft blicken, am Puls der Zeit sind sozusagen und deren genuine Aufgabe darin besteht, für möglichst viele Menschen offen zu sein. Funktionieren kann dies jedoch nur, wenn auch die Strukturen in den Kulturbetrieben selbst dynamisch agieren können – eine Herausforderung, deren Schwierigkeiten nicht klein geredet werden dürfen. Schnittpunkt dieser Dynamiken und der damit verbundenen Schwierigkeiten sind zumeist Führungskräfte, die – mit oder ohne Team – neue Impulse setzen, eine Richtung vorgeben und als direkte Ansprechpersonen die Haltung einer Unternehmung nach innen und außen transportieren. Eine komplexe Aufgabe, die sich zumeist in einer Person vereint und die es wert ist im Rahmen des Kulturmanagement Forums 2019 zu diskutiert zu werden.
Von der Verwaltung zum Outreach-Projekt
Karin Wolf, Direktorin des Instituts für Kulturkonzepte und damit selbst Führungskraft, nutzt das 25-jährige Jubiläum des Instituts, um ausnahmsweise selbst die Veranstaltung mit einer Keynote zu eröffnen. Als eine der Gründer_innen des Instituts kann sie auf über 25 Jahre Erfahrung zurückgreifen und auch einen kursorischen Einblick in die Entwicklung des Führungskräftebilds von Kulturbetrieben liefern: Waren die 1980er Jahre noch von der Prämisse der Verwaltung geprägt, ist in den 1990er Jahren zunehmend das Bedürfnis nach unternehmerischen Tools gestiegen; eine Veränderung, die nur mit der zunehmenden Ausgliederung und der Gründung von Kultur-Holdings verstanden werden kann. Dieses unternehmerische Bild von Kulturmanagement zieht sich in die Nullerjahre fort, bevor in den 2010er Jahren ein erneuter Wandel, hin zu einer strategischen Ausrichtung, zu beobachten ist. Publikumserreichung und -bindung, Kooperation, Kollaboration und Outreach sind die neuen Schlagworte, die in strategischen Prozessen analysiert und geplant werden möchten.

Das Arbeitsfeld der Kulturorganisation und die damit verbundene Führungsposition bergen viel Ambivalenz in sich. Ein Beispiel: Kulturbetriebe zeichnen sich durch eine flache Hierarchie aus. Aber hat eine Hierarchie nicht immer Unterordnung, Führung, Weisung, etc. implizit in sich? Wie kann eine klar vorgegebene, um nicht zu sagen starre, Struktur mit unterschiedlichen Befugnissen flach sein? Ein anderes Beispiel: Führungskräfte im Kulturbetrieb müssen sich gegenüber unterschiedlichen Stakeholdern verantworten, ihren Mitarbeiter_innen, ihrem Publikum, der Kulturpolitik, Geldgebern, gegenüber Kolleg_innen in anderen Kulturbetrieben. Dadurch eröffnet sich ein Spannungsfeld, das ein agiles, dynamisches und schnelles Reagieren auf neue Themen und Herausforderungen verlangt. „Gute Führungskräfte sind Generalist_innen“, sagt Karin Wolf dazu auch treffend und streicht gleichzeitig heraus, dass das Spartenwissen – Museum, Theater, Musik, etc. – nicht zu vernachlässigen sei. Dazu kommt die rasend schnelle Entwicklung im digitalen Bereich, die von Kulturbetrieben nicht abgekoppelt ist, sondern von dieser fruchtbar genutzt werden soll., Ist dafür ein holokratischer Ansatz, der Verantwortung im Team aufteilt und das gesamte Haus in Lösungsprozesse einbindet, vielleicht eine Möglichkeit? Karin Wolf verneint es nicht, kennt aber bis jetzt auch noch keine Kulturorganisation, die diesen ressourcenintensiven Changeprozess, der für tiefgreifende Veränderungen im Unternehmen sorgt, tatsächlich umgesetzt hat.
Neue Modelle für gesellschaftlichen Wandel
Karin Wolf nennt in ihrer Keynote drei wesentliche Faktoren, mit der sich Führungskräfte in Kulturbetrieben auseinandersetzen müssen: Zunächst ist da der kulturpolitische Auftrag, den eine Kulturorganisation sowohl von außen bekommt als auch von innen heraus für sich selbst definiert. Zweitens die Mittel und Ressourcen, die zur Verfügung stehen und drittens – und dies ist ein zentraler Punkt – die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die verändernd in Kulturbetriebe hineinspielen. Gerade Letzteres wirft die Frage auf, ob nicht auch Kulturbetriebe auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändernd wirken sollten oder könnten. Eine Utopie, die Karin Wolf zur Diskussion stellt, ist die des Vorbilds Kulturbetrieb, das ein anderes Menschenbild, einen anderen Umgang miteinander, in die Gesellschaft einbringt.
„Eine Kulturorganisation ist mehr als eine Kulturorganisation“, lautet dann auch die zentrale These von Karin Wolf. Ein Theater, um nur ein Beispiel zu nennen, lebt nicht nur allein vom jährlichen Spielplan, sondern von dem gesellschaftlichen Auftrag, das es hat. Dies impliziert für Führungskräfte sowohl Kommunikationsformen und -wege neue zu denken, als auch die Scheu vor Kooperationen abzulegen, aus denen neue gesellschaftspolitische Denk- und Handlungsmomente entstehen können.
Was Outreach-Projekte leisten können
Um beim Thema des gesellschaftlichen Wandels zu bleiben: Outreach-Projekte, wie partizipative Kulturvermittlungsprojekte nun gerne genannt werden, sind eine Möglichkeit, um mit Menschen in Kontakt zu treten, die aus strukturellen Gründen nicht oder nur einen eingeschränkten Zugang zu Kulturorganisationen haben. Das „Out“ in Outreach ist dabei in manchen Fällen wörtlich zu verstehen, geht es auch darum die eigene Kulturorganisation räumlich zu verlassen und zum Beispiel Orte in der Peripherie aufzusuchen. Dies fand und findet derzeit in Form von Stadtlaboren statt, wie Andrea Zsutty, Direktorin des ZOOM Kindermuseums, berichtet. Dazu braucht es sowohl mobile Angebote, die nicht an einen fixen Standort gebunden sind, als auch Kulturvermittler_innen, die über das notwendige sozialarbeiterische und sozialpädagogische Wissen verfügen, um mit dem Publikum in Kontakt kommen zu können. Dadurch, dass eine Institution, so Andrea Zsutty, sich nach außen öffnet und elitäre Standorte verlässt, gewinnt der Kulturbetrieb neue Sichtweisen und im Idealfall auch neue Kooperationspartner_innen,

Renate Aichinger, ehemalige Leiterin der offenen Burg am Burgtheater Wien, schließt hier direkt an und berichtet von ihren Bemühungen nicht nur Schulklassen mit dem Angebot der offenen Burg zu bedienen, sondern intergenerationelle Konzepte umzusetzen und ein Haus für eine breite Zielgruppe zu öffnen. Ein Ansatz, der auch auf Widerstand gestoßen ist, da die Bewertung von Vermittlungsprojekten nach quantitativen Maßstäben nur schwer möglich ist. Das gestattet einem aber, so Renate Aichinger, den eigenen Elfenbeinturm zu verlassen und offen und empathisch auf Menschen zu zugehen. Und auch mal dort hinzuschauen, wo es weh tut, unbequem sein und Veränderungen einfordern.
Transferleistungen für Kulturbetriebe
Kooperationen setzen zumeist ein interdisziplinäres Denken voraus, wie Elisabeth Noever-Ginthör, Leitung departure der Wirtschaftsagentur Wien, treffend feststellt. Die größte Schwierigkeit dabei: Jede Disziplin hat ihre eigene Sprache, was die Verständigung untereinander erschwert und vor allem zu Beginn viel Transferleistung bedarf. Doch auch gerade deswegen sind interdisziplinäre Projekte so fruchtbar, können sie doch eine Problemlage aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und so zu neuen kreativen Lösungen führen. Ein griffiges Beispiel dafür ist der Technologietransfer. Viele Branchen sind traditionell aufgestellt und kämpfen mit einer gewissen Schwellenangst davor neue Technologien zu implementieren. Die Kreativwirtschaft kann hier ein Motor für neue Entwicklungen sein, die sich auch mit der Frage beschäftigen, wie Technologien in Kulturbetrieben umgesetzt werden können. So kann ein Museum mit einem interaktiven, immersiven Ausstellungsangebot andere Zielgruppen auf innovative Weise ansprechen und so Kunstwerke und deren Bedeutung auf eine neue Art und Weise vermitteln.

„Man muss nicht alles alleine machen!“ ist dann auch die zentrale Aufforderung von Elisabeth Noever-Ginthör und nennt als Beispiel Vertriebskanäle, die nicht von einem Kulturbetrieb alleine genutzt werden müssen, sondern die in Form von Kooperationen auch anderen zur Verfügung gestellt werden können. Inklusive Mehrwert für die jeweiligen Häuser und deren Publikum. Schlussendlich geht es darum mit Neugier, Offenheit und Interesse an interdisziplinäre Projekte heran zu gehen und anfängliche Scheu hinter sich zu lassen.
Mit Gemeinwohlökonomie zur gesellschaftlichen Transformation
Über die gesellschaftliche Bedeutung von Kultur spricht Sven Hartberger, Intendant des Klangforum Wien. Das Klangforum Wien hat sich dazu entschieden sich selbst politisch eindeutig zu positionieren und diese Positionierung auch klar nach außen zu kommunizieren. „Denn womit sollen sich Kunst und Kultur sonst beschäftigen, wenn nicht mit gesellschaftlichen Themen?“ wirft Sven Hartberger als offene Frage in den Raum. Das soziale Leben einer Gesellschaft hat immer auch mit dem jeweiligen Wirtschaftssystem zu tun, innerhalb dessen es sich bewegt. Daher hat sich das Klangforum Wien auch dazu entschlossen sich selbst einem Gemeinwohl-Audit – siehe auch den Nachbericht zum Round Table #2 – zu unterziehen und die eigene Wirtschaftlichkeit mit anderen Maßstäben zu messen.

Kunst und dessen Erfahrung können, so Sven Hartberger, zu einer Transformation der Gesellschaft beitragen, indem sie persönlichkeitsentwickelnd auf Menschen wirken und neue Horizonte eröffnen. Mit der Gemeinwohlökonomie und der damit verbundenen Haltung geht eine andere Denkweise einher, die den Menschen ins Zentrum rückt. Der Vorteil für Kulturbetriebe liegt auf der Hand, können sie doch durch diese Denkweise ihren gesellschaftlichen Mehrwert nach außen transportieren sowie nach innen wirken.
Austausch, Vernetzung und Diskussionsstoff

Im Anschluss an die Impulsvorträge trafen sich die TeilnehmerInnen des Kulturmanagement Forums des Instituts für Kulturkonzepte zum kollegialen Austausch in Kleingruppen. Gemeinsam mit den Impulsvortragenden wurden deren Thesen und Konzepte diskutiert, auf ihre Machbarkeit überprüft und neue Kontakte für zukünftige Kooperationen und interdisziplinäre Projekte geknüpft. Das erfreulichste Ergebnis dieses Tages ist aber sicherlich die Gründung eines Stammtisches. Die Idee dazu stammt von Herbert Justnik, dem Direktor des Volkskundemuseums Wien. Aus diesen Treffen sollen zukünftige Projekte hervorgehen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen gestärkt werden.
Neben der Plattform Kulturmanagement Forum bietet das Institut für Kulturkonzepte auch Weiterbildungen speziell für MitarbeiterInnen und Führungskräfte von Kulturbetrieben an. Auch maßgeschneiderte Inhouse Trainings stellen wir gerne für Sie zusammen.

 Newsletter Anmeldung
Newsletter Anmeldung