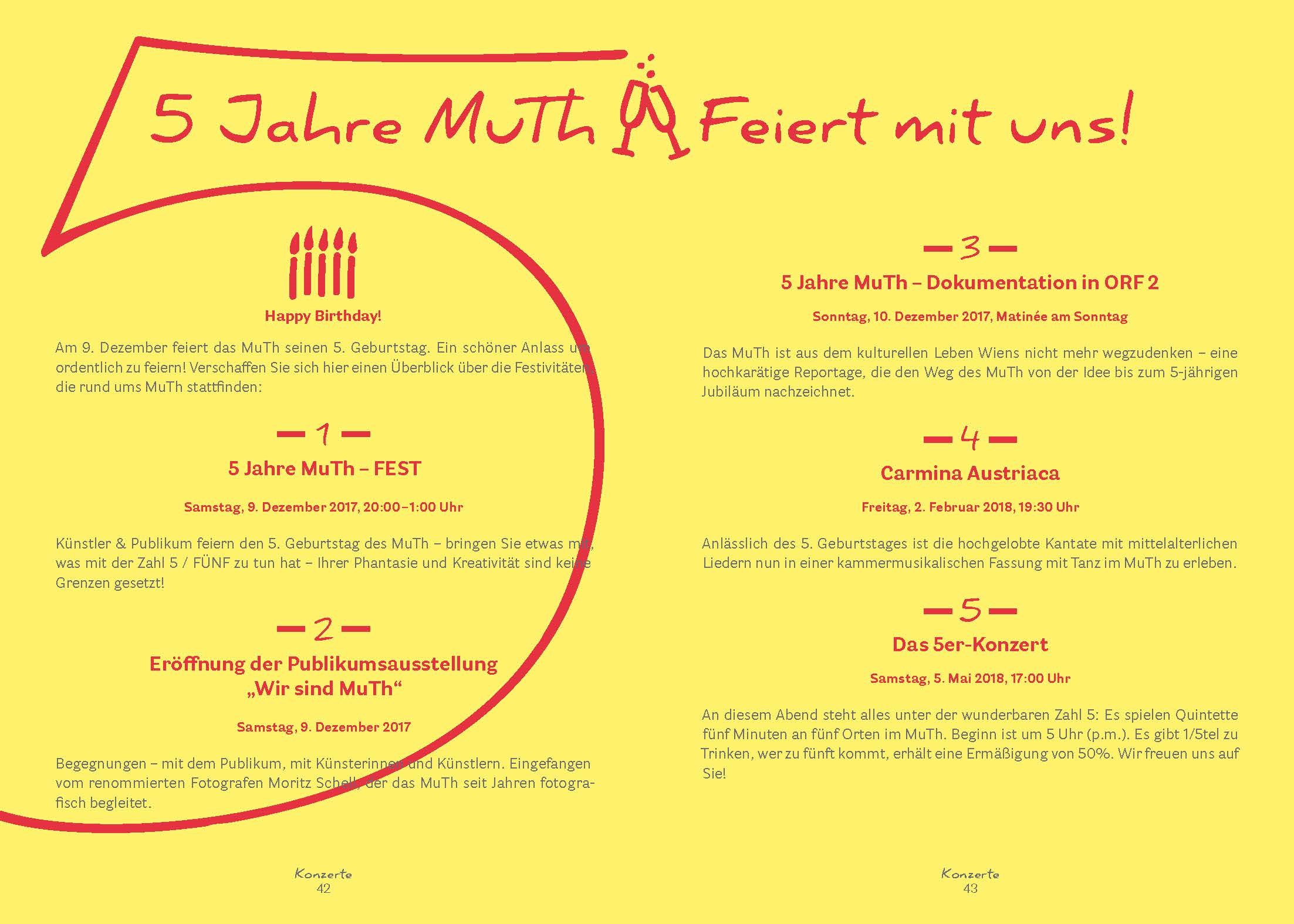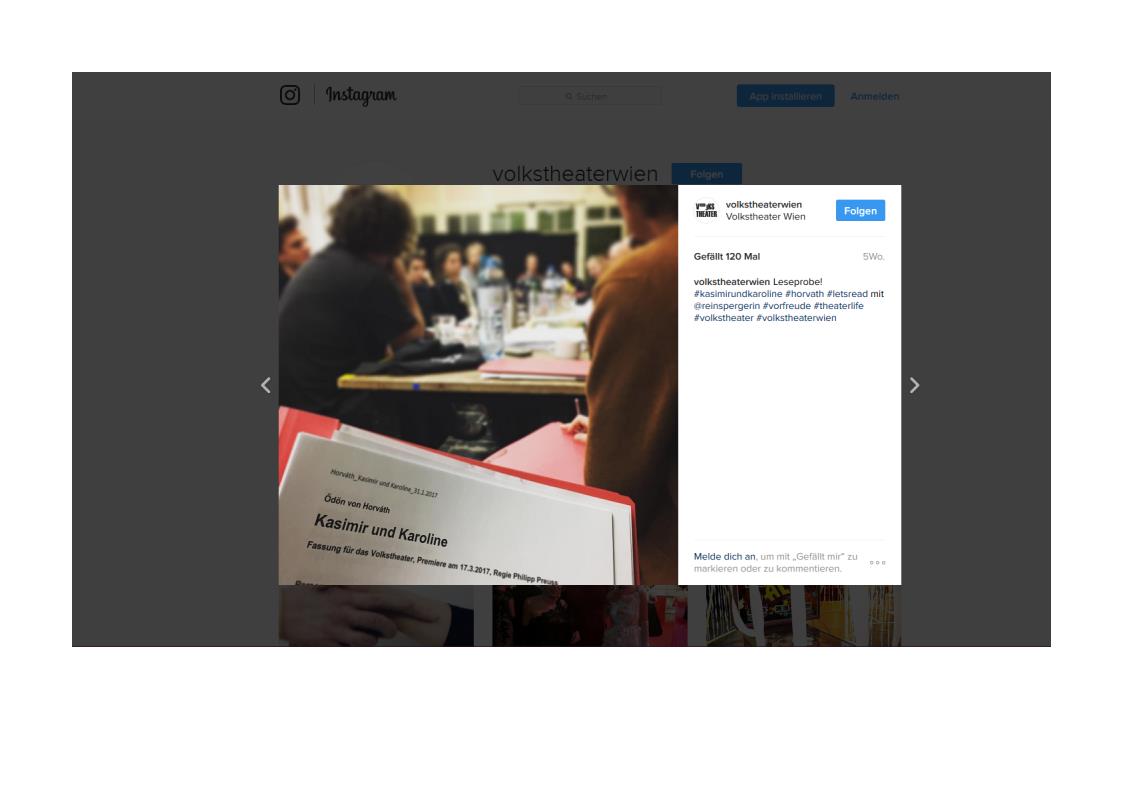Chance der Transformation
Die immer neuen Aufgaben von KulturmanagerInnen bedeuten Herausforderung und Chance zugleich

Ein Beitrag von Karin Wolf in Kooperation mit Kulturmanagement Network erschienen im KM Magazin Nr. 122 Mai 2017 zum Thema „Arbeitsmarkt Kultur: Themen & Hintergründe“
Der Kultursektor ist als Arbeitsplatz unverändert attraktiv. Auf öffentlich ausgeschriebene Stellen in Kulturbetrieben melden sich Hunderte BewerberInnen. Kulturmanagement-Ausbildungen, egal, ob einzelne Seminare oder mehrsemestrige Lehrgänge, sind gut gebucht. Paradoxerweise werden die Arbeitsbedingungen im Kultursektor von den zuständigen Interessensgemeinschaften zu recht immer wieder kritisiert. In Österreich hat die IG Kultur z.B. die Kampagne Fair Pay ins Leben gerufen, die dem Lohndumping entgegentritt und Honorarrichtlinien erstellt, um auf den Wert von Kulturarbeit (künstlerisch produzierender ebenso wie organisatorischer Arbeit) hinzuweisen.
Damit soll bei allen Beteiligten, den ArbeitgeberInnen und den ArbeitnehmerInnen, ein Bewusstsein für faire Arbeitsbedingungen geschaffen werden und längerfristig nachhaltige Verbesserungen erreicht werden. Menschen, die in der Kultur arbeiten, ist der ideelle Gewinn oft wichtiger, als der monetäre. Sie wollen sinnstiftende Arbeit leisten und die Gesellschaft mitgestalten. Die Auseinandersetzung mit künstlerischen Inhalten und Themen im Arbeitsalltag ist ihnen eine persönliche Bereicherung, ebenso wie der Umstand, dass sie die Möglichkeit haben, gemeinsam mit anderen eigene Ideen zu verwirklichen. Auch das Bild vom „schönen“ Arbeitsplatz ist nicht unwesentlich. Es gibt Menschen, denen es Freude bereitet, jeden Tag zur Arbeit in ein Theater oder ein Museum zu gehen. Sie besuchen, oft nach Dienstschluss, Aufführungen und Ausstellungen im Bewusstsein, einen ganz wesentlichen Teil am Zustandekommen geleistet zu haben. Damit partizipieren sie am Erfolg mit und erleben immer wieder eine Bestätigung der eigenen Leistung. Die Hierarchien in Kulturbetrieben sind flach im Vergleich zu Wirtschaftsbetrieben. Wenn ein Betrieb gut geführt wird, gibt es Kollegialität und Gemeinschaftsgefühl und die Möglichkeit, eine funktionierende Work Life Balance zu finden. KulturmanagerInnen stellen oft Selbstverwirklichung vor Auftragserfüllung und Gestaltungswillen vor Gewinnmaximierung, sie möchten sich im Laufe ihres Arbeitslebens kontinuierlich weiterentwickeln und dazu lernen.
Eine typische Karriere im Kulturmanagement kann als Studentenjob, an der Kasse oder an der Garderobe beginnen und im Lauf der Jahre Positionen in verschieden Abteilungen beinhalten bis zu einer Führungsposition wie Leitung des Marketing oder der Personalabteilung. Typisch ist auch die „Durchlässigkeit“ der verschiedenen Szenen: Menschen starten in der Alternativkultur und übernehmen später Positionen in etablierten Häusern. Auch die Kunstsparte kann sich im Laufe einer Kulturmanagement-Karriere ändern: von der Musik zum Theater, vom Filmfestival zur Oper. Ein zweiter Karriereverlauf ist die Selbstständigkeit, die manchmal eine Notlösung mangels Jobangebot, manchmal eine bewusste Entscheidung mit einer Geschäftsidee ist. Selbstständige KulturmanagerInnen sind oft im Umfeld der Creative Industries tätig, im Medien-, Design- oder Architekturbereich.
Egal, ob angestellt oder selbstständig, die Basis für alle notwendigen Kompetenzen ist eine unternehmerische Grundhaltung. Diese zeichnet sich aus durch eine Klarheit über die eigenen Ziele, eine realistische Einschätzung des Risikos und durch eine deutliche Haltung gegenüber aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Themen.

Gesellschaftlicher Auftrag für Kulturbetriebe
Die aktuellen gesellschaftlichen Transformationen führen dazu, dass KulturmanagerInnen zunehmend Aufgaben übernehmen, die über das Produzieren und Organisieren von Kunst und Kultur hinausgehen, wie z.B. soziales Engagement im Kontext der Flüchtlingsbetreuung oder der Bildungs- und Sozialarbeit. Auch die Politik knüpft Förderungen zunehmend an soziale Aufgaben oder Bildungsaufträge und ruft Programme und Projekt ins Leben, die migrantische bzw. gesellschaftliche benachteiligte Gruppen an die Kultur heranführen sollen. Damit ist kultur- und gesellschaftspolitische Haltung mehr gefragt denn je. Das wiederum ist eine Möglichkeit mehr, sich aktiv und gestaltend bei seinen Aufgaben einzubringen. Und vor allem auch mit anderen gesellschaftlichen Akteuren in Kontakt zu treten, denn der Kulturbetrieb kann es sich nicht mehr leisten, ein Elfenbeinturm zu sein.
Die wichtigsten Ausprägungen der Transformation mit Blick auf die Arbeit von bzw. in Kulturinstitutionen sind: stetiger Rückgang von Förderungen, verändertes Freizeitverhalten des Kulturpublikums, transkulturelle Gesellschaft und der Einfluss der neuen Medien auf alle Ebenen der Kommunikation.
Was gilt es also zu beachten, wenn eine Karriere im Kulturmanagement geplant wird? Im Kultursektor ist es besonders wichtig, auf die Wertschätzung der eigenen Leistung zu achten, das zeigt sich in der Qualität der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung. Ein realistisches Karriereziel ist es, sich als KulturmanagerIn gut bzw. sehr gut die Existenz zu sichern und eine erfüllende Tätigkeit zu verrichten. Dies kann nur gelingen, wenn man von Beginn an selbstbewusst und mit Nachdruck, den Wert der eigenen Arbeit kommuniziert und sich um die Bereitstellung ausreichender Ressourcen kümmert.
Es besteht immer die Gefahr, dass man sich durch das eigene große Engagement für die Kunst und die Freude an der Sache, dazu verleiten lässt, sich selbst und andere auszubeuten. Die eigenen Bedürfnisse und die des Teams dürfen nur in Ausnahmesituationen und nur für kurze Zeit (Premiere, Ausstellungseröffnung, etc.) hinter das künstlerische Anliegen gestellt werden.

Kulturmanagement Forum 2016, Foto: Corinna Eigner
Kompetenzen zur Bewältigung der Transformation
Traditionellerweise erlernen KulturmanagerInnen die notwendigen Fähigkeiten in der Praxis, individuelles Erfahrungswissen spielt in diesem sehr facettenreichen Beruf nach wie vor eine wichtige Rolle. Die Praxiserfahrung hat an Relevanz nichts verloren, wie ein Blick in Stellenausschreibungen beweist, wo diese immer gefordert ist. Gerade am Beginn der Karriere ist es wichtig, rasch in die Praxis einzusteigen und durch Projekte oder Praktika in möglichst unterschiedlichen Organisationen und Sparten Erfahrungen sammeln zu können.
Um mit den aktuellen und immer schneller stattfindenden Entwicklungen Schritt halten zu können, ist es unerlässlich, im Sinne der Karriereplanung auch die eigene Weiterbildung als Teil der Karriereplanung zu verstehen und sich regelmäßig neues Wissen anzueignen. Die Auswahl der Inhalte, die man sich aneignen möchte hängt von den individuellen Bedürfnissen, Interessen und Stärken ab. Bevorzugt werden kurze, kompakte und praxisorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote, die mit Berufstätigkeit vereinbar sind und eine gute Möglichkeit zur Vernetzung mit KollegInnen bieten.
Zu den Kenntnissen und Kompetenzen, die sich Menschen in einer Kulturmanagementausbildung aneignen möchten, zählen unverändert die „Klassiker“ Projektplanung und -organisation, Kommunikations- und Präsentationstechniken, Finanzierung und Förderung. Das Feld PR und Marketing befindet sich in permanenter Veränderung und Erweiterung durch die zentrale Rolle und rasante Entwicklung von Social Media und Internet. Wissen über Audience Development ist im Kontext der transkulturellen Gesellschaft notwendig.
Unternehmerisches Handeln (strategisches Denken, Führungskompetenz, betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse) gewinnt an Bedeutung, dem Umstand geschuldet, dass die staatlichen Förderungen zurückgehen und Geld zunehmend erwirtschaftet werden muss.

Wie stellt sich die Sache aus Sicht der Kulturbetriebe dar und was erwarten Kulturbetriebe von ihren MitarbeiterInnen? Kulturbetriebe sind durch die Reduktion der Förderungen oft vor die Entscheidung gestellt: Sparen am Programm oder Sparen am Personal? Leider führt das nicht selten dazu, das weniger Personal den gleichbleibenden Arbeitsaufwand leisten muss. Führungskräfte beantworten die Frage nach dem/r perfekten MitarbeiterIn oft mit folgenden Schlagworten: selbstständiges Denken, in der Lage Verantwortung zu übernehmen und Branchenkenntnis. Ungewöhnliche und abwechslungsreiche Lebensläufe stoßen durchaus auf Interesse, hier besteht in der Regel Offenheit für Individualität und Persönlichkeit. Das Bewusstsein, dass MitarbeiterInnen, einmal ausgewählt und eingestellt, auch Unterstützung innerhalb der Organisation bekommen sollen, setzt sich allerdings erst sehr langsam durch und manifestiert sich in einzelnen Häusern in regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, Inhouse-Trainings und Team-Entwicklungsseminaren.
Es zeichnet sich ab, dass jene Kulturinstitutionen, die in ihre MitarbeiterInnen und deren Weiterentwicklung investieren, die anstehenden Transformationen besser bewältigen werden.
Weiterführende Links:
Weiterbildung für Kulturbetriebe am Institut für Kulturkonzepte
Kulturmanagement Forum 2016 – Rückblick auf die Veranstaltung zum Thema „Der neue Kulturbetrieb“
Kulturmanagement Network & KM Magazin Mai 2017 „Arbeitsmarkt Kultur: Themen & Hintergründe“

 Newsletter Anmeldung
Newsletter Anmeldung